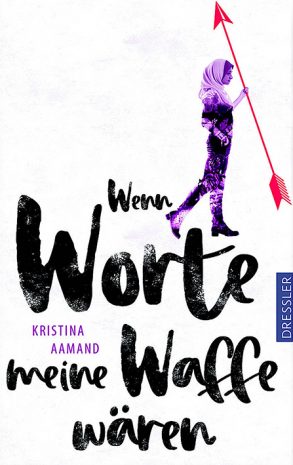Eines haben Sheherazade und Thea gemeinsam: jeweils ein Elternteil liegt im gleichen Krankenhaus. Sheherazades Vater hat ein stressbedingtes Herzleiden, das auf zehn Jahre zurückliegende Erlebnisse im Bürgerkrieg zurückgeht; Theas Mutter, eine Journalistin, liegt mit einer schwer zu diagnostizierenden Lähmungserscheinung auf der Intensivstation. Außer diesem Gemeinsamen könnten die Mädchen verschiedener kaum sein. Arabische Herkunft, Kopftuch, dunkle Hautfarbe bei Sheherazade. Blonde Haare, modische Jeans und indianische Ohrringe bei Thea. Für Thea gilt auch noch: wohlhabendes Elternhaus, systemkritische Weltsicht und alle Freiheiten, die sie sich nur wünschen kann. Aber es funkt zwischen ihnen, später werden sie sich sogar ineinander verlieben. Doch zunächst ist es ein zögerliches Kennenlernen. Thea nimmt die Freundin mit auf coole Parties, begleitet sie aber auch zu einem arabischen Frauentreffen, wo eine Hochzeit vorbereitet wird. Die 17-jährige Ich-Erzählerin Sheherazade beobachtet sich selbst dabei genau. Was passiert mit ihr? Wo will sie sich anpassen, wo nicht? Eine arabische Freundin begeht Selbstmord, weil ihre Ehe gescheitert ist und sie die Schande vor der Familie nicht ertragen kann. Ihre inneren Widersprüche artikuliert Sheherazade in „Zines“, kurzen Texten, in denen sie Erlebnisse wiedergibt, zeichnet und mit Zeitungsfetzen zu Collagen montiert. Sie leidet unter der sozialen Kontrolle des Ghetto-Viertels, unter den Vorwürfen der Mutter und eigenen Gewissensbissen, die von ihr als Streit zwischen einem weißen und einem schwarzen Engel wahrgenommen werden. Für die Geschichte ist weniger wichtig, dass sie – vorläufig – gut ausgeht (Sheherazade kann mit ihren Texten einmal auftreten, mit Billigung des Vaters). Wichtiger ist, wie komplex die kulturellen Grenzziehungen entwickelt werden und welche Schicksale von Nebenfiguren integriert sind. Die Autorin hat eine dänische Mutter und einen palästinensischen Vater und ist mit dem Milieu sehr vertraut. So liegt es nahe, mehr von Schwierigkeiten und Widersprüchen zu erzählen als ein harmonisches Ende zu konstruieren. Der Übersetzerin ist es gelungen, sprachlich zwischen der Ich-Perspektive des Erzähltextes und den noch stärker subjektiv orientierten „Zines“ zu differenzieren bzw. für beides einen eigenen Ton zu finden. Eine echte Herausforderung! Interessant wäre es, das Buch in einer kulturell heterogenen Gruppe zu lesen und zu diskutieren, am besten mit Jungen und Mädchen aus verschiedenen arabischen Herkunftsländern, denn auch zwischen diesen sind markante Unterschiede in den Wertungen und in der Diskussionsbereitschaft zu erwarten.
(Der Rote Elefant 37, 2019)