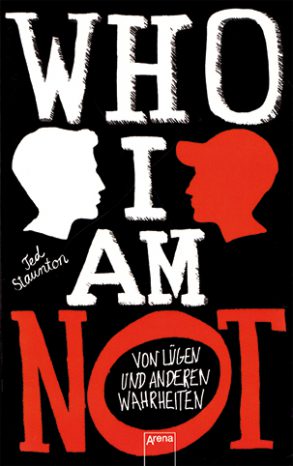Ein Zeitungsbericht inspirierte den in Kanada sehr bekannten Autor zu vorliegendem Roman. Dieses erste ins Deutsche übersetzte Buch beginnt in einem Supermarkt in Tucson/Arizona. Dort dreht der jugendliche Ich-Erzähler zusammen mit dem auf Geldkartenbetrug spezialisierten Pflegevater Harley wieder mal ein Ding. Doch diesmal geht etwas schief. Harley stirbt bei einem Autounfall und der Erzähler findet sich im Büro eines Jugendamtes wieder. Er gibt eine falsche Identität an, die er zuvor im Internet unter „Vermisste Kinder“ recherchiert hatte. Er sei der in Kanada seit drei Jahren vermisste Danny Dellomondo. Der Kontakt zur Familie wird hergestellt und der angebliche Sohn dorthin verbracht. Später erhellt sich, welches Interesse die Familie hatte, den „falschen“ Danny aufzunehmen. Tatsächlich weiß der Erzähler selbst nicht genau, wann er geboren wurde und wie er einmal hieß. Zu viele Pflegefamilien, zu viele Ausreißversuche, zu viele Täuschungsmanöver, zu viel Verdrängtes aus der „Bösen Zeit“. Erst als Danny sich verliebt und von sich erzählen will, merkt er, wie sehr er seine hybriden Identitäten vermischt hat, so dass er selbst nicht mehr herausfindet. „Ich erzählte Lügen, um die Wahrheit zu sagen.“
Die kriminellen Handlungsaspekte schaffen zwar zusätzliche Spannungsmomente, im Wesentlichen aber geht es um einen möglichen Selbstfindungsprozess trotz problematischer Kindheits- und Jugenderfahrungen. Erzähltechnisch reizvoll experimentiert Staunton dabei mit der Ich-Erzählung einer Figur, die ihr Ich ständig verschleiert, den Leser auf suggestive Art vereinnahmt, ihn permanent anspricht und ihn so in seine Geschichte(n) involviert. Der Leser wird veranlasst, dem Erzähler weitgehend zu glauben und sich so mit jemandem spielerisch zu identifizieren, der es mit fremdem Eigentum nicht genau nimmt und jede Situation erst einmal danach prüft, welche Fluchtmöglichkeiten es geben könnte. Letztlich entflieht „Danny“ jedoch auch dem Leser, indem er sich so verabschiedet: „Ich werde dir nicht sagen, wo ich jetzt bin. Sagen wir einfach, dass es mir gutgeht und ich im Indianer-Territorium bin.“
Das Buch provoziert Jugendliche dazu, sich gleich Danny dem eigenen Ich zu stellen, einem Ich, mit dessen Konstruktion auch sie gerade befasst sind. Das Spiel mit Wunsch-Identitäten könnte vor oder nach der Lektüre als Schreibimpuls aufgegriffen werden.
(Der Rote Elefant 33, 2015)